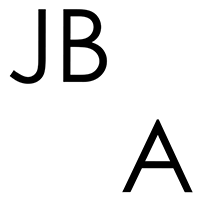„Schienenwege im Raum Köln“
097
Das Kreuzkonzept. Weiterentwicklung des Bahnknotens Köln
Der Bahnknoten Köln gehört zu den verspätungsanfälligsten in Deutschland. Glaubt man einer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Oktober 2023 veröffentlichen Analyse, ist der Knoten Köln trauriger „Spitzenreiter“: Nur 57 % der Verbindungen sind pünktlich, beinahe jeder zweite ICE hat Verspätung (vgl. FAZ, 05.10.2023, Thiemo Heeg und Dana Hajek: „Endstation Bahnhof“).
Die Ursachen dafür sind vielfältig: Die Station liegt äußerst zentral in der Millionenstadt. Was zur Folge hat, dass die zum Bahnhof führenden Gleistrassen mitten in dicht bebautem Gebiet liegen und kaum erweitert werden können, wodurch Kapazitätserhöhungen schwierig sind. Neben dem Hauptbahnhof gibt es zwar mit dem Bahnhof Messe/Deutz einen zweiten sehr zentral gelegenen Fernbahnhof, aber der kann den Hauptbahnhof kaum entlasten, weil er nicht weit entfernt liegt und somit nur ein geringes zusätzliches Einzugsgebiet für den Fern- und Regionalverkehr erschließt.
Die Norderweiterung des Hauptbahnhofs bringt nur vorübergehend Entlastung
Die Erweiterung sowohl des Hauptbahnhofs als auch des Bahnhofs Messe/Deutz um wenige Gleise in Richtung Norden ist planfestgestellt und wird sicherlich Entlastung bringen, allerdings bleibt die Wirkung begrenzt. Denn auf eine Erweiterung der jetzt schon sechsgleisigen Hohenzollernbrücke in Richtung Norden wird verzichtet. Somit dürfte die Brücke ein Nadelöhr im Bahnverkehr bleiben. Hinzu kommt, dass der S-Bahn-Verkehr in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden soll – hierfür werden die zusätzlichen Gleise benötigt, sodass sie schnell voll ausgelastet sein werden. Die entlastende Wirkung der Maßnahmen dürfte somit begrenzt bleiben.
Den Bahnhof zum Verschiebe-Bahnhof verschieben. Neuauflage einer alten Idee?
Paul Böhm hat die Idee ins Spiel gebracht, den Hauptbahnhof in den östlichen Stadtteil Kalk zu verlagern. An der östlichen Güterumgehungsbahn liegt dort die große Gleisharfe des Rangierbahnhofs Köln-Kalk – aus Böhms Sicht eine wenig genutzte Brache, die Platz für einen großzügigen Bahnhofsneubau böte.
Um der Geschichte gerecht zu werden: Die Idee, den Hauptbahnhof zu verlagern, um die herausfordernde Verkehrskonzentration nah am Dom zu entschärfen, ist nicht neu: Schon in der Zeit zwischen den Weltkriegen gab es Planungen, den Hauptbahnhof in den Bereich des späteren Aachener Weihers zu verlagern. Erst recht regten die massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs neue Stadtplaner-Fantasien an: Rudolf Schwarz schwebte eine Verlegung des Hauptbahnhofs an den Hansaring vor.
Die Attraktivität der Zentralität
Egal ob Böhm oder Schwarz – die Verlegungsvisionen kommen deswegen nicht recht in Fahrt, weil sie verkennen, wie viele Millionen und Milliarden Euro in der immer wieder erneuerten Infrastruktur am Kölner Hauptbahnhof am jetzigen Standort verbaut und investiert sind. Mitten im Herzen der Stadt aus- und umsteigen zu können, ist, bei allen Problemen, eine unschätzbare Qualität – nicht nur für Touristen, die vor der eindrucksvollen Kulisse des Doms aus den Zügen steigen, sondern auch für die Kölner:innen, für die der Hauptbahnhof ein aus allen Teilen der Stadt in etwa gleich gut erreichbarer Verkehrsknotenpunkt bildet.
Egal, ob Kölner:innen in die Innenstadt fahren oder eine Fahrt ins Umland antreten wollen: Immer ist der extrem zentral gelegene Hauptbahnhof Ziel- und Umsteigepunkt. Würde er in die rechtsrheinische Peripherie verlegt, würde er diese Zentralität schlagartig einbüßen. Sofort müsste ein großer Aufwand betrieben werden, die Streckenkapazitäten nach Kalk massiv auszubauen, um den neuen Bahnhof für die mehrheitlich linksrheinisch lebenden Kölner:innen erreichbar zu machen. Dies ist kaum vorstellbar angesichts der Schwierigkeiten in Köln, das vorhandene Streckennetz in Schuss und in Betrieb zu halten und angesichts der noch kommenden (und sinnvolleren) Großprojekte Ost-West-Achse und Metrolinien-Konzept.
Die „Kalker Lösung“ ist erkennbar aus der Sicht eines Stadtplaners oder Architekten gedacht: Die große Fläche des Rangierbahnhofs ist ohne Zweifel ein städtebauliches „Filet-Grundstück“, das Entwicklungs- und Vermarktungsphantasien anregt. Verkehrlich macht sie aber kaum Sinn, da eine so weit vom Stadtzentrum entfernt liegende Tangente eine viel zu geringe verkehrliche Wirkung entfaltet.
Berlin macht es uns vor: Kreuz statt Tangente!
Nach 1990 hatte Berlin ein ähnliches Problem wie Köln heute: Die Trasse der „Berliner Stadtbahn“ schlängelt sich mitten durch die Innenstadt. Durch die Zunahme des Zugverkehs infolge der Wiedervereinigung war absehbar, dass diese Trasse früher oder später an eine Kapazitätsgrenze stoßen würde. Statt sie immer mehr zu verbreitern, entschied man sich, Verkehrsströme zu entzerren: Die Ost-West-Bahn-Verkehre verblieben auf der Stadtbahn-Trasse, die Nord-Süd-Verkehre wurden auf einer eigenen neuen Trasse in einem Tunnel geführt, der im 90°-Winkel auf die Stadtbahn-Trasse zuläuft. Am Schnittpunkt von Stadtbahn-Trasse und Nord-Süd-Tunnel wurde der neue Berliner Hauptbahnhof errichtet. Als „Turmbahnhof“ sitzt er genau über dem Kreuzungspunkt der Trassen.
Der verkehrliche Clou des Berliner „Pilzkonzepts“ ist die Entzerrung der Zulaufstrecken zum Hauptbahnhof. Statt die aus verschiedenen Richtungen in die Stadt kommenden Verkehre auf einer Trasse vor dem Hauptbahnhof zu bündeln, gibt es eine im rechten Winkel dazu auf den Hauptbahnhof zuführende zweite große Trasse. Kreuzförmig angeordnete Zulaufstrecken haben gegenüber linear angeordneten den Vorteil, dass sie deutliche höhere Kapazitäten aufnehmen können und deutlich weniger anfällig für Verspätungen sind. Denn falls ein Trassenstrang durch einen betrieblichen Zwischenfall blockiert ist, gibt es zusätzliche, die den Verkehr dann aufnehmen können.
Das Kreuzkonzept
An den hochbelasteten Bahnknoten in Deutschland wird gearbeitet: Hamburg plant einen Verbindungsbahn-Entlastungstunnel, Frankfurt am Main arbeitet an seinem Fernbahntunnel, München bekommt seine Zweite Stammstrecke. Und Köln? Am wichtigsten Bahnknoten in Deutschlands größtem Ballungsgebiet wird mit zusätzlichen Gleisen „herumgedoktort“ - sinnvoll sicher, aber kein großer Wurf.
Köln helfen weder ein paar zusätzliche Gleise noch Verlegungsphantasien. Köln hilft eine zusätzliche Zulaufstrecke zum Hauptbahnhof. Möglich ist dies mit einer ca. 90° zur alten Trasse liegende neue Achse, die den Bahnhof in einem Tunnel unterirdisch anfährt. Da sich bestehende und neue Trasse im Hauptbahnhof kreuzen, war eine Projektbezeichnung für die Studie rasch gefunden: das Kreuzkonzept.
Betriebliche Vorteile:
- Entlastung der westlichen Umfahrung der Innenstadt ("Gleis-Schlinge")
- Kapazitätserhöhung des gesamten Bahnknotens und Verkürzung der Reisezeiten für Nord-Süd-Verkehre
- Kapazitätserhöhung des gesamten Bahnknotens und Verkürzung der Reisezeiten für Nord-Süd-Verkehre
- Verbesserung der Umsteigebeziehungen durch möglichen Entfall des Fernverkehrshalts Köln Messe/Deutz
- Beibehaltung des hochurbanen, lebendigen und zentralen Hbf-Standorts (anders als im "Böhm-Konzept")
- Einsparung der Kosten für eine Komplettverlegung des Hbf ("Evolution statt Revolution")
- Verringerung der Belastung der oberirdischen Strecken durch Fernverkehrszüge, dadurch Erhöhung der Nahverkehrskapazitäten möglich
- Erhalt des Breslauer Platzes als "Ort des Ankommens" mitten in der Stadt, ohne weitere Umstiege in den ÖPNV
Städtebaulich Vorteile:
- Gleisflächen des Rangierbahnhofs Kalk-Nord bleiben als Reserven für den zukünftigen weiteren Ausbau des Schienengüterverkehrs und evtl. als gewerbliche Reserveflächen erhalten (keine "Zubetonierung" und "Verplanung" der weiterer großen Potentialflächen in Köln)
- keine weitere Vergrößerung der Gleisanlagen des Hbf zu Lasten des Breslauer Platzes
- Einrichtung eines Fahrradschnellwegs auf freiwerdenden oberirdischen Gleisflächen möglich
- Weiterentwicklung weiterer bestehender Gleisflächen zu ökologisch + stadtklimatisch wertvollen Freiräumen
- An ausgewählten Stellen wird eine Randbebauung des Bahndamms möglich, die für eine bessere städtebauliche Einbindung der Bahntrasse sorgt
- An sehr zentralen Standorten könnte so Raum für bezahlbares urbanes Wohnen und Arbeiten entstehen